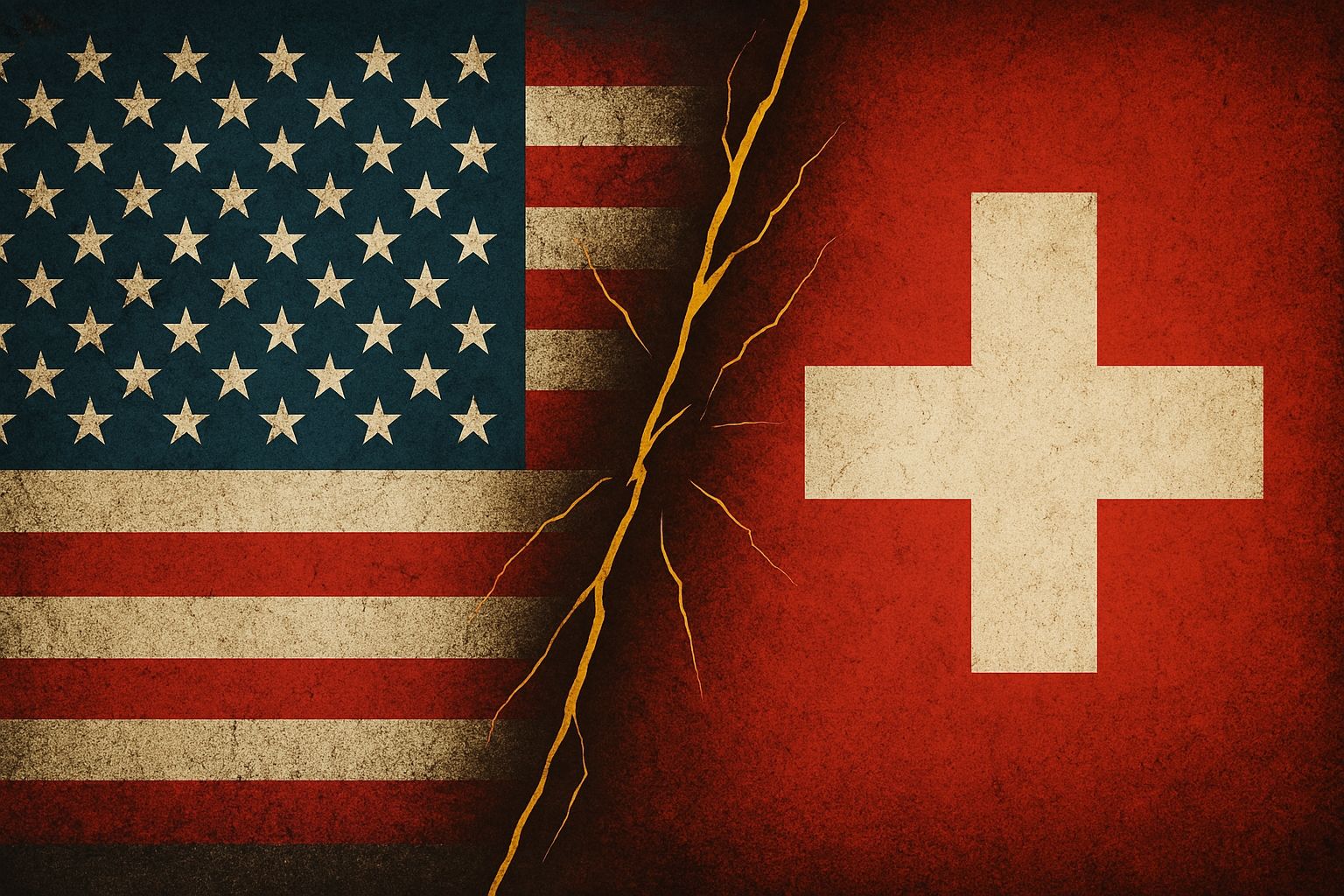Europa hat Trump zu lange nicht ernstgenommen – nun bezahlt es teuer dafür
Donald Trump sagte es in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident, er sagte es im Wahlkampf 2024, und er sagte es diese Woche in aller Brutalität: Die Amerikaner sind nicht mehr bereit, für Europas Sicherheit zu bezahlen. Die Europäer sollen selber dafür sorgen.
Eine Überraschung kann das nicht sein. Trotzdem sitzt der Schock tief, nachdem der Präsident und seine Minister ihre Vorstellungen konkretisiert haben. Man könnte sie so zusammenfassen: Trump dealt mit Putin die Friedensbedingungen aus. Er bekommt Zugriff auf die Rohstoffe in der Ukraine. Und Europa? Europa sitzt nicht am Tisch. Soll dann aber, wenn der Krieg zu Ende ist, mit eigenen Geldern und Soldaten sicherstellen, dass die Ukraine nicht erneut angegriffen werden kann.
Die Europäer waren auf das Unvermeidliche völlig unvorbereitet. Die EU wirkt paralysiert. Ihr grösstes Mitgliedsland Deutschland steckt im Wahlkampf, in dem Aussenpolitik bloss ein Randthema ist. Einzig Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erfasste sofort, dass es nun eine europäische Antwort auf Trumps Vorgehen braucht. Er lud zur Konferenz nach Paris. Dort aber wurde klar, wie uneins Europa ist. Während der britische Premier bereit wäre, Truppen zur Friedenssicherung in die Ukraine zu schicken, winkte Deutschlands Kanzler sofort ab.
Sehenden Auges ins Desaster geschlittert
Die Empörung über Trump und seine Lügen zur Ukraine – sie habe den Krieg provoziert, Selenski sei ein Diktator – ist berechtigt. Aber Empörung schafft keine Sicherheit. Die Ukraine gehört zu Europa. Die EU und alle europäischen Länder müssen sich fragen: Warum sind wir sehenden Auges in dieses Desaster geschlittert? Weshalb haben wir uns nicht für diesen Fall gewappnet? Was läuft schief, wenn die Militärbudgets der europäischen Länder den gesamten russischen Staatshaushalt übersteigen, wir aber ohne die Amerikaner trotzdem verloren sind?
Warnungen gab es lange vor Trump. Der damalige US-Präsident Barack Obama mahnte bereits 2012, die Europäer müssten mehr für die Nato zahlen. Es war absehbar, dass nach dem Zusammenbruch des Sowjet-Kommunismus die Amerikaner ihr sicherheitspolitisches Interesse allmählich verlieren würden. Trump spricht es jetzt aus: Er sieht China und die illegale Immigration an der Südgrenze der USA als die grösste Bedrohung für die Sicherheit Amerikas.
Ob er Europa wirklich sich selbst überlässt, ist dennoch zu bezweifeln. Bei Trump weiss man nie, was ernst gemeint ist und was bloss Druckmittel in Verhandlungen ist. Er verlangt neuerdings, dass die Nato-Länder 5 Prozent ihres Budgets für Verteidigung aufwenden statt wie bisher 2 Prozent. Die USA sind schon bei 3 Prozent. Interessanterweise hat sich am WEF in Davos auch Selenski für 5 Prozent ausgesprochen. Und vergangenes Wochenende forderte er in München die Schaffung einer europäischen Armee.
Höhere Armeeausgaben sind angesichts des russischen Aufrüstens unabdingbar; da öffnen Trump wie Selenski den Europäern die Augen. Seit der Jahrtausendwende haben diese beim Militär gespart. Das gilt auch für die Schweiz. Das eingesparte Geld – die Friedensdividende – gaben sie anderswo aus, vor allem für den Sozialstaat. Genau dort müsste jetzt gekürzt werden, sollte das Militär aufgerüstet werden. Geschweige denn, wenn eine europäische Armee und eine wettbewerbsfähige Waffenindustrie aufgebaut werden würden.
Umschichtungen vom Sozialen zur Armee sind unpopulär, und anders als die USA hat die EU keinen Anführer, der mit Dekreten durchregieren kann. Die einzelnen Länder haben meist schwache oder wacklige Regierungen. In Deutschland dürften an diesem Sonntag über 30 Prozent für Parteien stimmen, die tendenziell pro-russisch sind (AfD, BSW, Linke). Das sind schwierige Voraussetzungen für den Vollzug der Zeitenwende.
Tatsache ist: Will Europa nicht anfällig sein für Putins Expansionsgelüste, muss es ihn glaubwürdig abschrecken können. Das Atomarsenal Frankreichs und Grossbritanniens hilft dabei. Bloss darauf zu hoffen, dass Trump es sich nochmals überlegt oder dass nach ihm wieder ein Transatlantiker kommt – das wäre 35 Jahre nach dem Endes des Kalten Krieges fahrlässig.