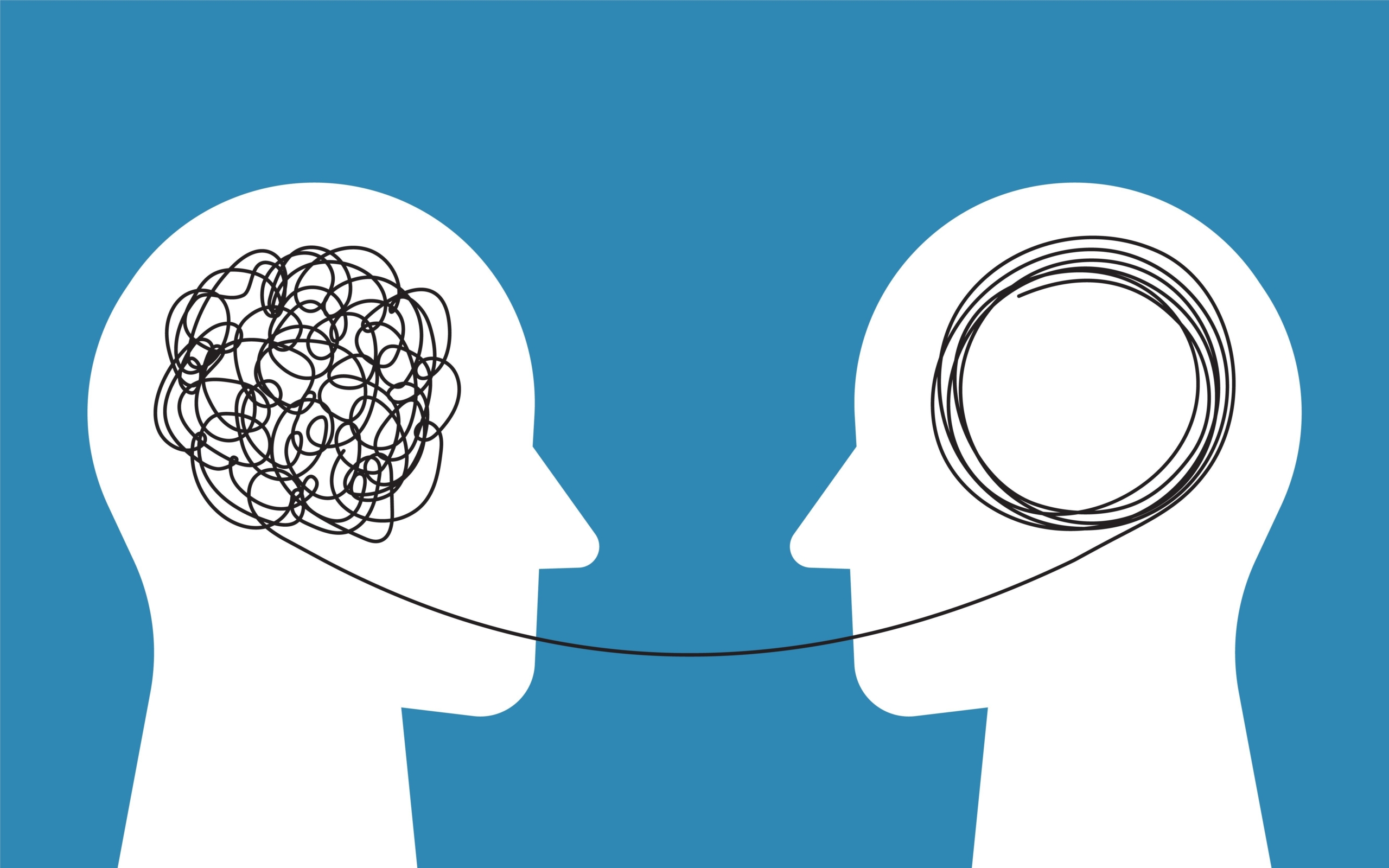Überlasteter Arbeitsspeicher: Darum funktioniert EMDR bei posttraumatischem Stress
Angstanfälle, Flashbacks oder andere körperliche oder emotionale Symptome: Wer Gewalt erlebt, kann ein psychisches Trauma erleiden. Dieser posttraumatische Stress kann mit der EMDR-Methode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) behandelt werden. Dabei müssen sich die Patienten an das traumatisierende Erlebnis erinnern und gleichzeitig Augenbewegungen durchführen.
Dass die Therapie wirkt, ist unbestritten. Noch ist allerdings nicht ganz klar, weshalb sie das tut. Doch nun zeigen drei Forscherinnen der Universität Freiburg: Es hat wohl mit dem Arbeitsspeicher im Gehirn zu tun, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heisst.
Sie haben die Hypothese untersucht, wonach die EMDR-Sitzung durch die doppelte Aufgabenstellung zu einer Überlastung führt. Die Vermutung: Der Konkurrenzkampf um begrenzte Speicherkapazitäten sorgt dafür, dass die traumatisierenden Erinnerungen weniger lebendig sind.
Zwei gleichzeitige Aufgaben verschieben Aufmerksamkeit
Dazu haben sie Daten aus verschiedenen aktuellen Studien ausgewertet. Prompt zeigte sich: Bei denjenigen, die zwei Aufgaben erledigen mussten, führte dies zu einer «stärkeren Reduktion der emotionalen Intensität einer Erinnerung» als bei Teilnehmenden, die nur eine Aufgabe hatten – also sich zum Beispiel auf die Erinnerung zu fokussieren ohne die Augen zu bewegen.
«Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Arbeitsspeicher-Hypothese richtig ist», wird Dany Laure Wadji in der Mitteilung zitiert. Zwei gleichzeitige Aufgaben führe zu einer Verschiebung der Aufmerksamkeit und damit zu einer reduzierten Emotivität. «Dies hilft letztlich, ein Trauma zu verarbeiten sowie etwaige Symptome zu lindern.» Die Freiburger Studie soll nun den Weg ebnen für umfassendere klinische Untersuchungen. (abi)