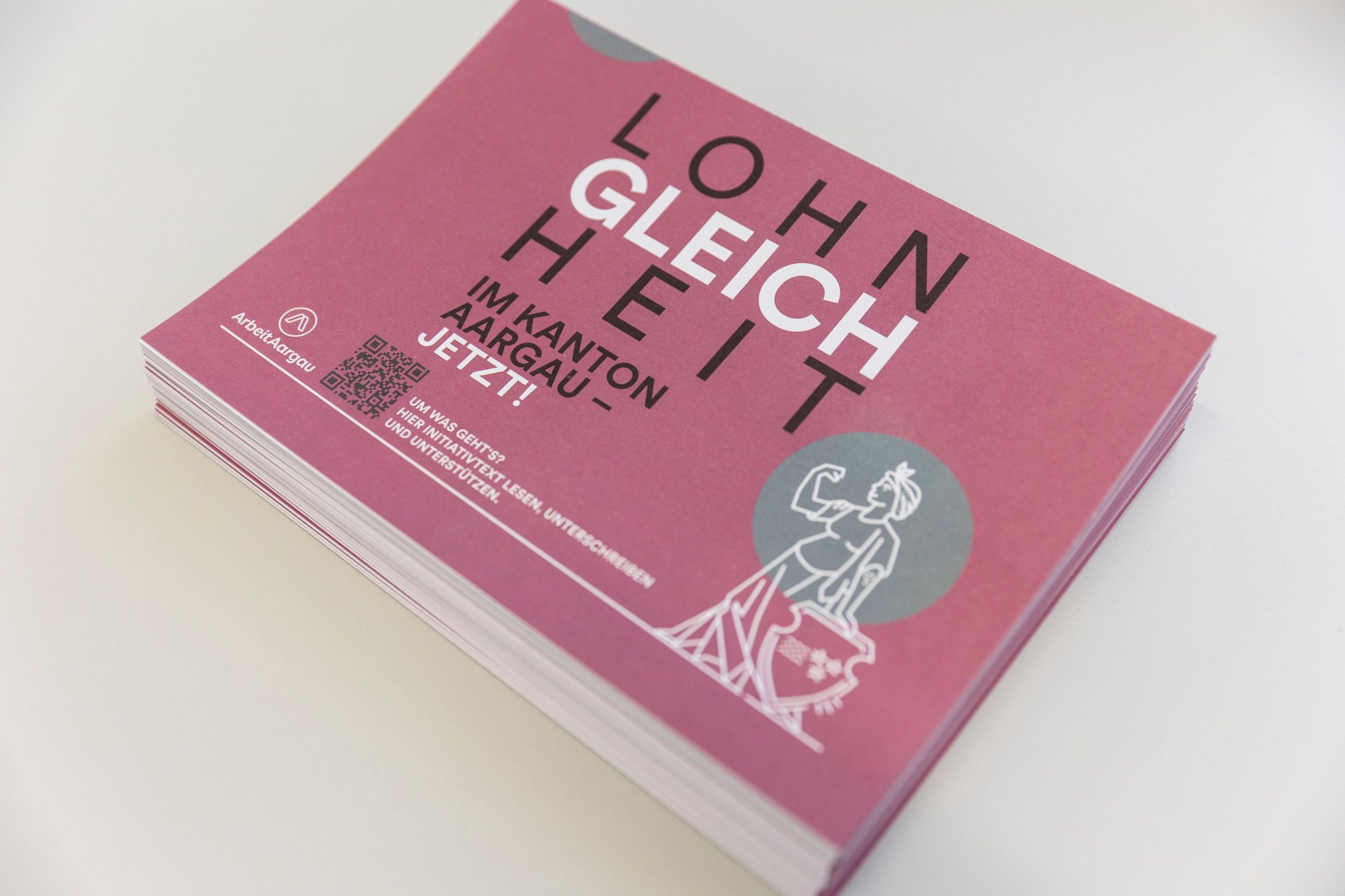Die Biodiversitätsinitiative verfolgt das richtige Ziel – doch legt den falschen Fokus
Es ist schön, beim Spazieren einen Storch klappern zu hören. Heute nistet er im Mittelland wieder wie selbstverständlich, noch vor siebzig Jahren galt er als ausgestorben. Zurückgekehrt ist er nicht einfach so, sondern dank gezielten Massnahmen wie Nisthilfen. Der Grossteil aller Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz entwickelt sich aber in die entgegengesetzte Richtung: Ein Drittel aller Arten und die Hälfte der Lebensraumtypen gelten als bedroht, gefährdet oder ausgestorben. Das schmerzt nicht nur Naturfreunde, sondern gefährdet die Stabilität unserer Ökosysteme. Dem will die Biodiversitätsinitiative entgegenwirken, über welche wir am 22. September abstimmen.
Die Initiative will natürliche Lebensräume besser schützen. Sie fordert, mehr Flächen unter Schutz zu stellen, um Natur und Landschaften langfristig zu bewahren. Zudem verlangt sie weitere Massnahmen, um die biologische Vielfalt in Schutzgebieten und ausserhalb zu verbessern.
Wer hierbei nicht versteht, was bei der Annahme der Initiative genau passieren würde, hat deren Kernproblem erkannt: Wie viel zusätzliche Fläche und wo diese unter Schutz gestellt werden sollte, legt die Initiative nicht fest. Dies lässt viel Spielraum für Interpretation und schafft Unsicherheit. Das Resultat: Die Gegnerschaft droht auf ihren Abstimmungsplakaten damit, dreissig Prozent der Schweiz würde unter Schutz gestellt. Das ist Unsinn. Wird die Initiative angenommen, sorgt das Parlament für deren Umsetzung. Wie gering der Einfluss von Natur- und Umweltschützerinnen auf die beiden Kammern ist, zeigt die gescheiterte Suche nach einem mehrheitsfähigen Gegenvorschlag – die Gegnerschaft der Initiative kann also beruhigt sein.
Der grösste Schwachpunkt der Initiative ist aber, dass sie auch den Schutz der Baukultur fordert. Ein Gegenvorschlag hätte es richten und diesen Aspekt aus dem Initiativtext kippen können. Denn mit der Förderung von Biodiversität hat er nichts zu tun. Doch das ist alles Konjunktiv. In der Initiative ist der Schutz der Baukultur nicht nur präsent, sondern im Gegensatz zu den Biodiversitätszielen auch klar formuliert: Schutzwürdige Landschaften, Ortsbilder und Denkmäler sollen «bewahrt werden». Man muss keine Juristin sein, um zu erkennen, dass dieses Wort begrenzt Interpretationsspielraum zulässt.
Die unsinnige Verknüpfung mit der Baukultur macht es leicht, die Initiative abzulehnen – selbst wenn man die Biodiversität verbessern will. Die Gegner wollen aber nicht nur, dass die Initiative an der Urne abstürzt. Sie verneinen, dass es schlecht steht um die Biodiversität in der Schweiz. Die Überlegung: Ein Nein zur Initiative wäre in ihren Augen ein grundsätzliches Nein zu mehr Biodiversität.
Mitten im Abstimmungskampf präsentierte der Bauernverband eine in Auftrag gegebene Studie, die zeigte, dass der Zustand der Biodiversität keineswegs besorgniserregend sei. Die begleitende Botschaft: Es gibt keinen Handlungsbedarf, die Biodiversität zu verbessern. Einige Arten nehmen zu, andere ab – was will man machen. Die Bauern täten jedenfalls bereits viel, und zwar ganz freiwillig.
Dass sich die Auftragsstudie nicht mit dem Stand der Wissenschaft deckt, zeigt eine öffentliche Stellungnahme, die über 200 Forschende unterschrieben haben. Sie stellt fest: Der Zustand der Biodiversität in der Schweiz ist besorgniserregend. Die bisherigen Anstrengungen und Massnahmen reichten nicht aus, um die Artenvielfalt und Lebensräume sowie die Funktion der Ökosysteme zu schützen und zu fördern. Daher sei es zwingend, die Biodiversität mit raschen und griffigen Massnahmen zu fördern.
Die Schweiz hat seit 2012 eine Strategie Biodiversität und seit 2017 einen Aktionsplan, der bis Ende 2024 läuft. Wie dessen Wirkungsanalyse gezeigt hat, wurden die bisherigen Ziele nicht erreicht. Ein Nein zur Initiative sollte nicht als Absage an die Biodiversität verstanden werden. Dafür müssen die Bauern endlich einsehen, dass biologische Vielfalt für sie und die Gesellschaft essenziell ist. Nun soll der Bundesrat einen griffigen Aktionsplan vorlegen; geschieht das nicht, muss das Parlament nachbessern.