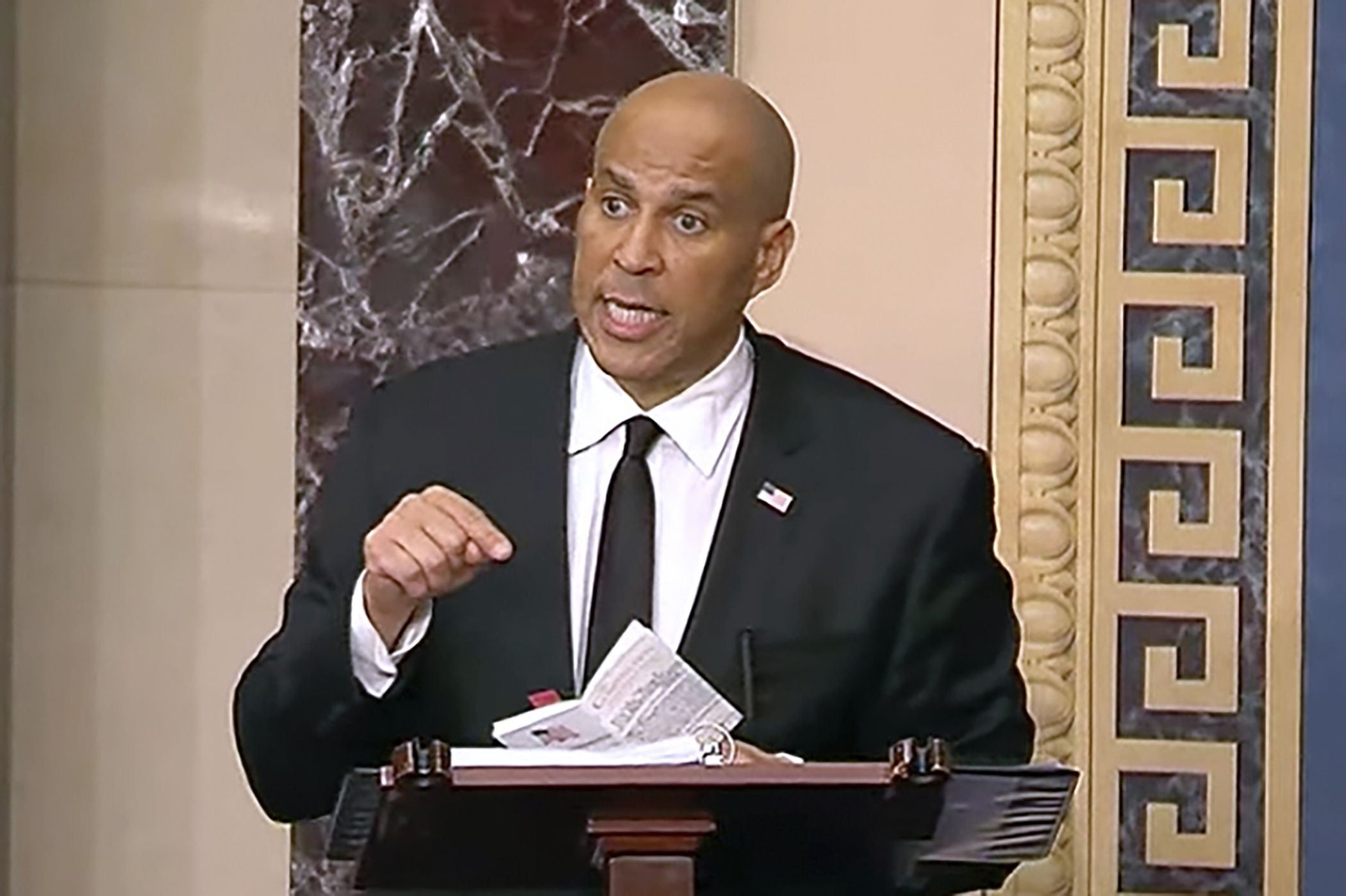Wer wissen will, wie das Geschworenengericht in den USA funktioniert, sollte diesen Film schauen
Eine Gerichtsmaus müsste man diese Woche sein. Dann könnte man heimlich jenen zwölf New Yorkerinnen und New Yorkern beim Debattieren zuhören, die über Donald Trumps Schicksal entscheiden. Denn auch im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten entscheiden zwölf zufällig ausgewählte Personen darüber, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. So will es das angelsächsische Justizsystem.
Diese zwölf Geschworenen sind zu ihrem Schutz anonym, ihre Beratungen sind streng geheim – Telefone müssen draussen bleiben, Protokolle werden keine geführt. Kein Aussenstehender wird je erfahren, was sich in ihrem Gerichtsraum abspielt: Wer wie argumentiert, mit welchen Indizien oder welchen Zeugenaussagen, und wie sie zu ihrem Schluss kommen.
Man kann sich aber einen Film ansehen, der einen Eindruck davon gibt, wie es in einem Geschworenenzimmer so zugehen kann. Sidney Lumets Klassiker «Die zwölf Geschworenen» von 1957 spielt sogar nur drei Gehminuten vom Schauplatz des Trump-Prozesses entfernt, am Obersten Gerichtshof New Yorks in Downtown Manhattan – dem Ex-Präsidenten wird im architektonisch weit hässlicheren Strafgericht der Prozess gemacht.
Der Film zeigt, wie ein Juror, gespielt von Henry Fonda, die Meinung der elf anderen kippen kann. Mit Charisma, Diplomatie und logischen Argumenten. Der Film ist ein psychologisches und rhetorisches Meisterstück sowie letztlich ein Plädoyer für Aufklärung und Humanismus.
30 Prozent aller Amerikaner sind einmal in ihrem Leben Juror
Zu Beginn des Films ist Fondas Charakter der einzige, der einen 18-jährigen Angeklagten nicht innert fünf Minuten zum Tod verurteilen mag. Man kann es der Mehrheit nicht ganz verübeln, dass sie so schnell wie möglich aus diesem Zimmer, in das sie bis zum Entscheid gemeinsam eingeschlossen worden sind, wieder rauswollen. Es ist unerträglich schwül-heiss und der Ventilator will nicht anspringen.
Ein Juror schleudert niesend seine Viren in den Raum, ein anderer möchte möglichst schnell an ein Baseballspiel, ein weiterer lässt seine rassistischen Vorurteile durchblicken. Er wisse ja selbst nicht, ob der Junge schuldig oder unschuldig ist, sagt Fondas Juror Nummer acht, «aber lasst uns wenigstens darüber reden, wenigstens eine Stunde». Schliesslich gehe es um das Leben eines jungen Menschen.

Bild: Rights Managed/ www.imago-images.de

Bild: zvg
«12 Angry Men» heisst der Film im englischen Original, «12 wütende Männer». Es wird viel geschrien und gestritten; einmal kommt es fast zu Handgreiflichkeiten. Diese Jury besteht aus lauter weissen Männern. Denn Frauen wurden lange für zu emotional für diese Aufgabe gehalten, Menschen anderer Hautfarbe diskriminiert. Heute ist die Zusammensetzung der Jurys repräsentativ für die Bevölkerung. Dreissig Prozent aller Amerikaner kommen wenigstens einmal in ihrem Leben dieser Bürgerpflicht nach.
Die Jury im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump besteht aus fünf Frauen und sieben Männern unterschiedlicher Hautfarben, Zivilstände und Alterskategorien – hinzu kommen sechs Ersatzjurorinnen und -juroren. Sämtliche achtzehn mussten vor dem Richter glaubhaft versichern, dass sie in der Lage seien, «fair und unparteiisch» zu urteilen; alle haben sie den gesamten Prozess im Gerichtssaal verfolgt. Die Geschworenen müssen keinerlei juristische Kenntnisse haben, Laien werden in der Regel bevorzugt. Es ist deshalb eher ungewöhnlich, dass im Trump-Fall zwei von ihnen Juristen sind.
Der Entscheid muss einstimmig fallen
Während des wochenlang laufenden Prozesses werden die Jurorinnen und Juroren nicht in einem Hotel abgesondert, wie es manchmal der Fall ist, sondern dürfen zu Hause übernachten. Sie sind aber angehalten, keine Nachrichten zum Fall zu konsumieren und mit niemandem darüber zu sprechen. Man fragt sich, wie das heutzutage möglich sein soll. Es ist ihnen strikt verboten, einen Schauplatz des Verbrechens aufsuchen oder eigene Indizien mitzubringen – wie es Juror Nummer acht im Film tut.
Im Film wie in der Realität müssen die Geschworenen ihren Entscheid, wie auch immer dieser ausfällt, einstimmig treffen. Gelingt das nicht, so spricht man von einer «hung jury», einer blockierten Jury. Das führt zu einem Fehlprozess. Der Staat könnte dann versuchen, den Prozess noch einmal von vorne aufzugleisen. Doch zu einer «hung jury» kommt es erstaunlich selten, gemäss Statistiken nur in etwa sechs Prozent der Fälle.
Die 12 Geschworenen haben es in der Hand
Jurys bekommen jeweils die Anweisung, keinen berechtigten Zweifel («reasonable doubt») zu hegen. Eine Formulierung, die einiges an Spielraum offenlässt. Sie beruht auf dem fundamentalen Prinzip der Strafjustiz: der Unschuldsvermutung – im Zweifel für den Angeklagten. Im Film überwiegt der Zweifel schliesslich, der junge Mann darf am Leben bleiben. Die Jury macht gut, was ein schlechter Pflichtverteidiger versäumte.
Bei Trump geht es nicht um Leben oder Tod. Trump ist auch kein armer Schlucker. Vielmehr kann er sich nicht nur einen, sondern ein ganzes Team der teuersten Anwälte leisten. Manche New Yorker befürchten sogar, dass jemand aus Trumps Umfeld versuchen könnte, einen Juror zu bestechen.
Der gesamte Prozess glich öfter einer Seifenoper, bei der etwa ein Pornostar, ein lügenhafter Anwalt und ein schmieriger Boulevardblattverleger als Zeugen auftraten. Und nun könnte der Prozessausgang Trumps Chance auf eine Wiederwahl schmälern oder vergrössern. Die zwölf Geschworenen haben es in der Hand. Man wäre wirklich gerne eine Gerichtsmaus in ihrem Juryzimmer.