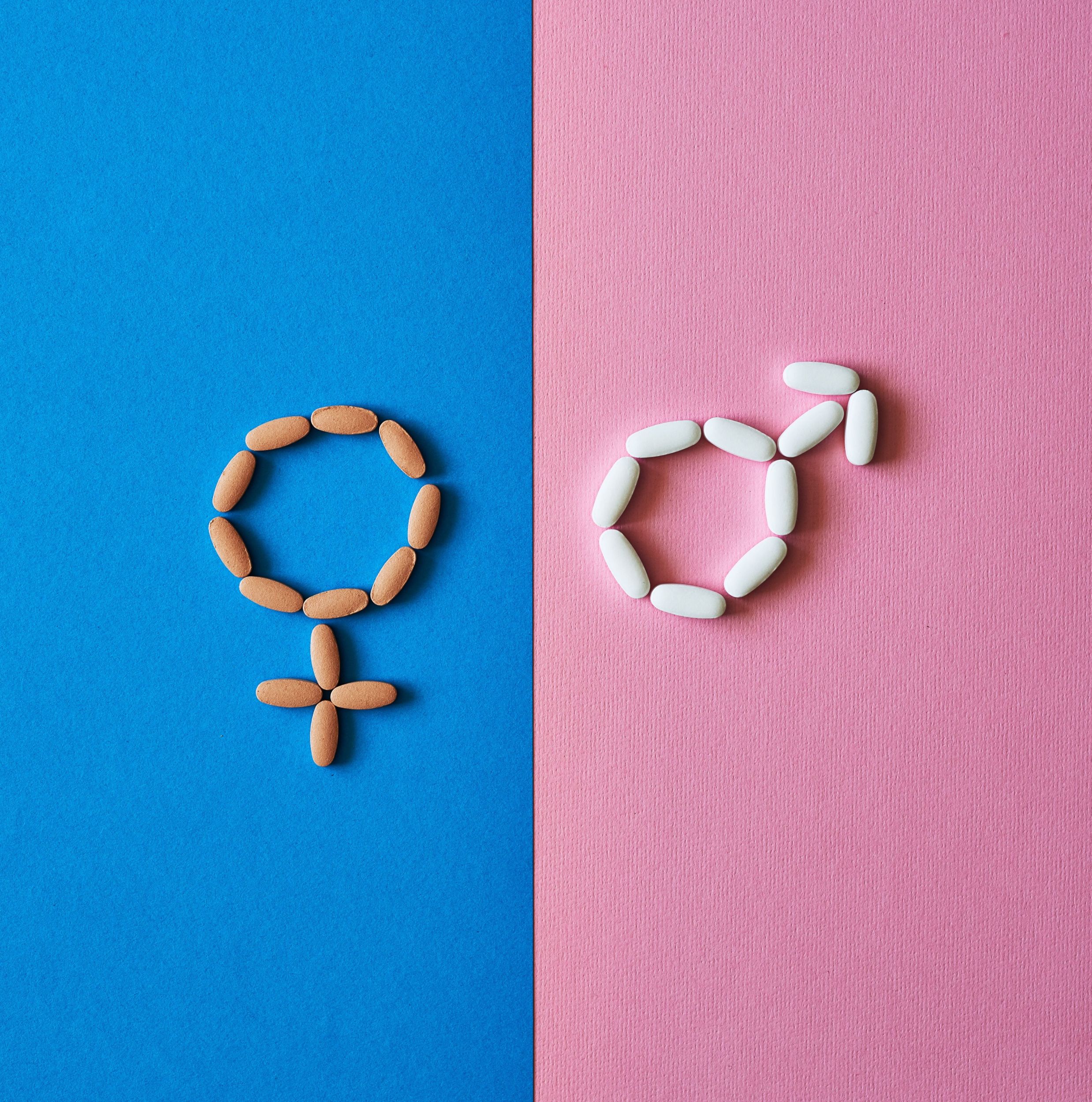
Wie die Norm des männlichen Körpers Gleichstellung in der Medizin verhindert
Der Mann ist in der Medizin die Norm, die Frau vernachlässigt. Die Folge: Abgesehen von den Sexualorganen wurden biologische Unterschiede bisher ignoriert und kaum erforscht. Dies stellen die Autorinnen des Forschungsberichts «Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten» fest, den sie im Mai im Auftrag des Bundes publiziert haben.
Die drei Autorinnen haben sich damit befasst, wie sich das biologische Geschlecht und die Geschlechterrollen (soziales Geschlecht) auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten auswirken. Im Folgenden zeigen wir anhand vier exemplarischen Problemfeldern aus dem Forschungsbericht auf, was getan werden muss, um Männer und Frauen medizinisch gleichzustellen.
1. Herzinfarkt als «Männerkrankheit»
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in der Schweiz – und weltweit – die häufigste Todesursache, bei Männern und bei Frauen. Dennoch haben sie den Ruf, bei Männern häufiger aufzutreten, und gelten als sogenannte «Männerkrankheiten». Obschon die Krankheiten besser erforscht sind als noch vor einigen Jahren, werden sie bei Frauen immer noch später erkannt und bleiben unterdiagnostiziert. Das zeigt sich daran, dass Frauen mit Schmerzen in der Brust heute noch 2,5-mal seltener an die Kardiologie überwiesen werden als Männer.
Ein Grund dafür ist, dass Frauen eine grössere Zahl an verschiedenen und im Vergleich zu den Männern teilweise atypischen Symptomen aufweisen, beispielsweise Schmerzen zwischen den Schulterblättern, Übelkeit, Erbrechen oder Kurzatmigkeit. Auch wenn Frauen ähnliche oder sogar schwerere Krankheitsverläufe aufweisen, werden sie seltener auf Intensivstationen eingewiesen als Männer. Die fixe Idee, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen handle es sich um «Männerkrankheiten», verhindert es, die Krankheit bei Frauen zu erkennen. So erklärt Tina Büchler, Co-Autorin des Berichts, auf Nachfrage: «Die starren Vorstellungen von Männern und Frauen verstellen oftmals den Blick darauf, was wirklich vorhanden ist.» So sei der Herzinfarkt genauso wenig eine Männerkrankheit, wie Brustkrebs eine Frauenkrankheit sei.
Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Frauen jedoch nicht nur bei der Diagnose benachteiligt, sondern auch in der Therapie und der Rehabilitation. Die Patientinnen nehmen seltener und kürzer Reha in Anspruch als Männer und brechen sie häufiger ab. Dies obwohl die Reha die Sterblichkeitsrate und die Zahl an Re-Hospitalisationen senken kann. Die Autorinnen begründen dies so, dass Frauen seltener eine Reha angeboten wird oder dass sie verhindert sind, eine zu machen, da sie für Angehörige sorgen oder Kinder betreuen müssen. Das Beispiel in Therapie und Rehabilitation, so die Autorinnen, stehe exemplarisch dafür, dass die Benachteiligung in der Gesundheitsversorgung nicht allein auf die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zurückzuführen sei.

Bild: Getty
2. Mehr Demenzerkrankungen, seltenere Diagnose
Demenz, die Krankheit, bei der das Gedächtnis nachlässt, sich der Orientierungssinn verschlechtert und die Vergesslichkeit überhand nimmt, ist bekannt als Krankheit älterer Menschen. Weniger im Bewusstsein der Bevölkerung ist, dass zwei Drittel aller Demenzerkrankten Frauen sind.
Obwohl sie deutlich häufiger betroffen sind als Männer, werden demenzielle Erkrankungen wie Alzheimer bei Frauen seltener oder später diagnostiziert. Das ist damit zu erklären, dass die Gedächtnistests, um die Krankheit zu erkennen, auf Männer ausgerichtet sind. Denn bei diesen Tests schneiden Frauen aufgrund ihrer sozialen Rolle oft besser ab. Häufig sind sie es – gerade in Familien – die planen, koordinieren, kommunizieren. Der vermeintliche Vorteil der besseren Gedächtnisfähigkeit führt zu einer verspäteten Diagnose oder Nichterkennung von Demenz bei Frauen. Als Massnahme schlägt der Bericht vor, die Tests künftig gendersensibel zu gestalten. Im Fall von Demenz brauche es ein auf Frauen abgestimmter Test.
Ein Problem, der späten Diagnosen bei Frauen sei auch, dass diese Unsichtbarkeit als Rechtfertigung verwendet werde, warum Männer in in entsprechenden Studien dominieren, statt auf die Wissenslücken in Bezug auf die Diagnostik bei Frauen zu fokussieren. Ein Teufelskreis. Die Autorinnen fordern gendersensible Tests für die Diagnostik sowie mehr institutionalisierte Angebote, um bestimmte Krankheiten wie Alzheimer schneller zu erkennen. Der Bund plant ab 2025 eine nationale Plattform «Demenz», um dieses Defizit zu beheben.
3. Medikamente führen öfters zu Nebenwirkungen
Zwar erhalten Frauen öfters Psychopharmaka verschrieben als Männer, gleichzeitig ist bei ihnen das Risiko für Nebenwirkungen doppelt so hoch. Mit dem männlichen Körper als Norm hat sich in der Medikamentenentwicklung ein sogenanntes «Einheitsmodell» durchgesetzt. Gemäss diesem werden Arzneimitteltests von der Grundlagenforschung bis hin zu klinischen Studien überwiegend an männlichen Tieren und Männern durchgeführt. Das bedeutet, dass sehr viel Wissen zum weiblichen Körper schlicht fehlt und Unterschiede bei der Wirksamkeit respektive in Bezug auf die Toxizität übersehen werden.
Dass Frauen von der Forschung ausgeschlossen wurden, wird bis heute damit begründet, dass der Menstruationszyklus von weiblichen Tieren oder Frauen die Resultate verfälschen könnte. Durch den schwankenden Hormonspiegel würden die Ergebnisse variabler und weniger eindeutig ausfallen als jene der Männer, so die Befürchtung. Jüngste Forschungsergebnisse entkräften jedoch diesen Mythos weiblicher Variabilität. Dennoch sind auch in der aktuellen medizinischen Forschung männliche Zellen, Tiere und Menschen überpräsent.
So wurde in der Forschung beispielsweise lange ignoriert, dass Frauen und Männer unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Der Stoffwechsel und das Hirn funktionieren anders. Als Folge des männlichen Bias in der Behandlungsentwicklung bei Medikamenten leiden Frauen häufiger an Nebenwirkungen als Männer, Behandlungen sind zudem oftmals weniger wirksam oder sogar kontraproduktiv, etwa wegen ungeeigneter Dosierungen oder Behandlungskombinationen. Die Autorinnen stellen fest, dass es künftig mehr geschlechtersensible Behandlungs- und Dosierungsfindungsstudien braucht, damit Wissens- und Datenlücken geschlossen werden.
4. Endometriose plagt jede zehnte Frau
Jede zehnte Frau leidet an Endometriose. In der Schweiz gibt es mehr als 200’000 Betroffene. Erste Medienberichte finden sich bereits Mitte der 1990er-Jahre. Trotzdem dauert es heute noch sechs bis neun Jahre, bis eine Frau die Diagnose erhält.
Endometriose ist eine Krankheit, die ausschliesslich weibliche Körper betrifft. Bei der Krankheit wuchert die Gebärmutterschleimhaut ausserhalb der Gebärmutterhöhle im Beckenbereich oder auch im Bauchraum. Wenn sich die Gebärmutterschleimhaut zusammenzieht und Monatsblutungen beginnen, tut sie dies bei Betroffenen überall da, wo die Schleimhaut wächst, was zu lokalen Entzündungen und starken Schmerzen führt.
Die vielen verpassten und späten Diagnosen bei Endometriose haben einen Grund: Menstruationsbeschwerden werden häufig nicht ernst genommen. Zudem bestehen sowohl in der Forschung, der Prävention und der Versorgung grosse Lücken. Die Therapiemöglichkeiten sind limitiert. Sie erfordern eine hohe Spezialisierung und da Endometriose chronisch auftreten kann, beides bedeutet hohe Kosten.
Handlungsbedarf sieht der Forschungsbericht sowohl darin, dass Hausärzte für die Krankheit geschult werden sollen. Ebenfalls müsse bei der Krankheit auch die Langzeitversorgung in den Fokus rücken. Derzeit mangelt es zum Beispiel an Unterstützung zur Wiedereingliederung in die Arbeitswelt nach einer Operation und an Beratungen, wie mit Schmerzen und psychischer Belastung umgegangen werden soll.





