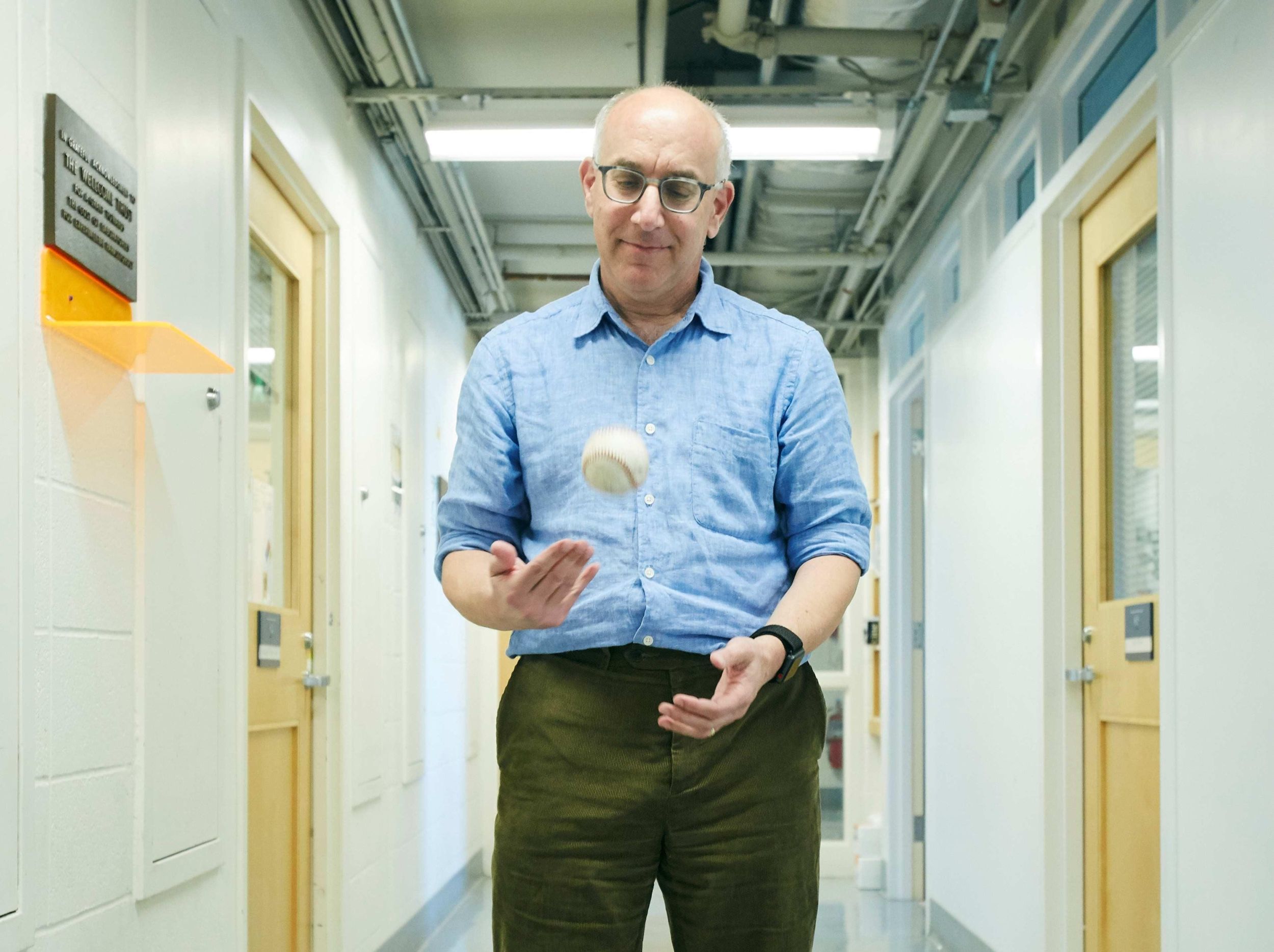«Ich fände es sehr lustig, wenn die SVP einen schwulen Bundesrat hätte»: Literaturstar Kim de l’Horizon
Noch selten hat sich im deutschsprachigen Raum eine Autorin oder ein Autor mit so viel Wucht ins literarische Firmament katapultiert wie Kim de l’Horizon. Vor kurzem kannte die non-binäre Person noch so gut wie niemand. Dann erschien ihr Débutroman «Blutbuch», in dem sich die non-binäre Hauptfigur Kim mit ihrem Leben und ihrer Vergangenheit befasst. Der Roman wurde frenetisch besprochen und gewann sowohl den Schweizer als auch den Deutschen Buchpreis – was bisher erst einer Autorin gelang. Wir treffen Kim de l’Horizon in Zürich in einer Bar zum Kaffee und begegnen einer sehr zuvorkommenden und sanftmütigen Person.
Kim de l’Horizon, wie geht es Ihnen?
Kim de l’Horizon: Es fühlt sich an, als würde ich in einem Film mitspielen, bei dem jemand plötzlich beschlossen hat, dass ich die Hauptfigur sei. Dabei habe ich gemeint, ich sei eine Statistenperson. Gleichzeitig ist die Situation auch überfordernd, das Buch ist ja mein Début.
Sie sind nach Ihren überwältigenden Erfolgen stolz auf sich?
Alle auf der Liste der Nominierten hätten die Preise verdient. Ich finde diesen Erfolg ein wenig unverhältnismässig …
Aber es ist Anerkennung, und darum geht es ja auch in Ihrem Fall …
Anerkennung ist sehr schön. Aber auch komisch, man träumt davon, und plötzlich ist sie da. Trotzdem muss ich weiterhin meine Wäsche machen und will meine Freundschaften pflegen: Ich möchte nicht, dass der Erfolg in meinem Privatleben allzu viel verändert.
Ihr Buch ist im renommierten Verlag Dumont erschienen. Wie viele Verlage haben es vorher abgelehnt?
Die Agentur hat das Manuskript sehr vielen angeboten und anfangs nur Absagen erhalten. Ich weiss gar nicht, wie oft das passiert ist. Letztlich wollten es aber vier Verlage publizieren, und ich entschied mich für Dumont.
Im Klappentext des Romans steht, dass Sie sich mit «Hexerei» auseinandersetzen. Was ist Hexerei für Sie?
Die Vorstellung, dass alles wie in einem Zauber miteinander verknüpft ist. Wenn man an einer Ecke des Stoffs zieht, bewegt man das ganze Tuch, die ganze Welt. So entsteht auch Leid, oft unbewusst. Der Wunsch ist, dass wir so mit allem Leben wieder in ein liebevolles Verhältnis kommen.
Wenn in Ihrem Verständnis alles mit allem, Belebtes und Unbelebtes wie Fäden in einem Tuch miteinander verbunden ist, wie wirkt der Preissegen nun weiter?
«Blutbuch» wird als genderpolitisch wichtiger Beitrag wahrgenommen. Mich haben allerdings mehr die Mutterfiguren und die Familientraumata interessiert. Deshalb hoffe ich, dass das Buch einen kollektiven Heilungsprozess auslöst, bei den transgenerationalen Traumata, die Dinge, die wir unbewusst über Generationen weitergeben, die wir verschweigen, eine Sprache bekommen.
Transgenerationale Traumata kennt man bei Holocaustopfern oder Familien mit Wurzeln in der Sklaverei. Wo findet sich in einer schweizerischen, gutbürgerlichen Familie derart Monströses?
Es geht um das Leiden der Frauen, das sich über Generationen weitererzählt. Von der Grossmutter, die nicht um ihretwillen geliebt wird, sondern Stellvertreterin ihrer verstorbenen älteren Schwester ist, bis zu Kim.
Männer interessieren Sie in Ihrem Buch rein gar nicht …
Über sie ist bereits genug berichtet worden. Traditionellerweise werden Geschichten vor allem über Männer erzählt. Jetzt muss es einmal um die Nichtmänner gehen.
Ihre Erzähl- und Hauptfigur heisst ebenfalls Kim. Wie viel von Ihnen, der Autorenperson, steckt in ihr?
Verwandelt sicher viel, das Buch ist eine Autofiktion. Man begegnet einer literarischen Figur, die mir gleicht, die aber nicht ich bin.
Zehn Jahre haben Sie an ihrem «Blutbuch» gearbeitet. Gab es Momente, in denen Sie alles in eine Ecke schmeissen wollten?
Sicher, ständig! Und ich dachte mir bei jedem Neubeginn, dass ich gescheitert sei. Bis ich gemerkt habe, das Scheitern und die Brüche sind unvermeidlich, sie gehören dazu, wenn man über ein Thema wie meines schreibt.
Dann haben die sprachlichen Brüche also mit dem Prozess zu tun und nicht mit der Idee: Ich erfinde Sprache neu, weil ich nicht nur den Geschlechterstereotypen, sondern auch den normativen Zuschreibungen an die Sprache entkommen will?
Ich wollte mit den Brüchen nicht den Konventionen den Stinkefinger zeigen. Ich wollte den Schreibprozess ernst nehmen; und wenn man Dinge ernst nimmt, finden sie ihren eigenen Weg und es passiert etwas Neues. Ohne dass es mit dem «Gring dur d’ Wand» entsteht. Der Text ist vielgestaltig, aber er soll die Leserinnen und Leser an der Hand nehmen. Es war nicht meine Absicht, dass er sperrig sein soll. Im Gegenteil, das Buch will gelesen werden.
Sie haben den Roman also für ein Publikum geschrieben. Dann ist es ein Missverständnis, wenn man es ihn als Selbstbefreiung einer non-binären Person liest?
Ja, das denke ich. Es geht nicht in erster Linie um Non-Binarität. Für mich ist sie lediglich die Möglichkeit, die der Figur hilft, um mit den Traumata umzugehen. Und um einen Heilungsprozess einzuleiten.

Keystone
Es gibt im Roman den schönen Moment, in dem Kim merkt, dass man sich entscheiden muss. Entweder ist man Bub oder Mädchen. Haben Sie das auch so erlebt?
Wenn ich Kinder beobachte, sind sie frei und haben Freude, heute ein Röckli zu tragen und morgen zu «tschutten». Sie tun, was ihnen im Moment Spass macht. Und das sollte das Ziel sein: Man soll Kindern möglichst lange einen Freiraum geben, damit sie sich ausprobieren können, bevor sie in eine Schublade gesteckt werden. Man kann von Kindern lernen, dass das biologische Geschlecht keine Essenz, kein Kern in uns allen ist, sondern ein sehr persönliches Körpergefühl, das auch in Bezug auf die Sexualität divers gelebt werden soll.
Es geht um die Unterscheidung von biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht?
Auch das biologische Geschlecht gibt es in dreierlei Hinsicht. Es gibt das anatomische, das hormonelle und das genetische Geschlecht. Dabei hängt allein der Hormonspiegel von vielem ab, vom Alter und von einer sportlichen Betätigung. Das heisst, das biologische Geschlecht ist ein Baukasten, der unglaublich komplex ist.
Die offizielle Schweiz akzeptiert nur zwei Geschlechter, und in Ihrem Pass steht «männlich». Ist das für Sie ein Affront?
Ja, das ist es. Es müssten mindestens drei Geschlechter anerkannt werden, weiblich, männlich und non-binär. Aber genauso wichtig ist es, dass die Gesellschaft ihre Geschlechterbilder aufweicht.
Sie fühlen sich sowohl männlich als auch weiblich.
Ja, mal mehr männlich, mal mehr weiblich.
Und gerade jetzt?
Derzeit bin ich gerade ein bisschen indifferent. (Kim trägt ein bisschen Lippenstift, Nagellack, einen schlichten Pullover, Hosen und eine goldene Jacke.) Es gibt aber Momente, in denen ich mich klar mehr dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühle – das ist oft der Fall, wenn ich mich unter Männer begebe. Manchmal ist das bloss ein intimes Gefühl. Manchmal will ich dem aber auch zum Ausdruck verhelfen und ziehe ein Kleid an.
Und wie fühlen Sie sich beim Schreiben?
Dann fühle ich mich oft fluid. Ich komme in einen Flow und alles ist möglich. Schreiben ist für mich existenziell und auch sehr körperlich. Ich schreibe mit meinem Körper.
Geht es Ihnen mit Ihrer Non-Binarität auch um Selbstverwirklichung?
Das Geschlecht ist Teil meines Körpers. Darüber will ich selber verfügen und es ausleben können. Der Staat hat sich da nicht einzumischen. Die Freiheit, sein Geschlecht selber wählen zu können, ist eine durch und durch liberale Idee. Allerdings nicht in einem neoliberalen Leistungsdenken, nicht im Sinne, dass man sich ständig optimieren muss. Die Mehrheitsgesellschaft kann von queeren Menschen lernen, dass man sein Inneres lustvoll und spielerisch ausleben kann – dazu gehört auch das Geschlecht.
Wohl 99 Prozent aller Menschen sagen, dass sie sich klar als Mann oder als Frau zugehörig fühlen. Glauben Sie, dass viele Menschen sich nicht eingestehen können, non-binär zu sein.
Untersuchungen aus den USA zeigen, dass sich 30 Prozent der Jugendlichen queer und elf Prozent non-binär fühlen. Es ist die erste Generation, die mit der Vorstellung aufwächst, dass das okay ist, und nicht mehr einen enorm starken Druck erlebt, sich das ausreden zu müssen. Dazu beiträgt sicher auch das Internet. Man kommt in Kontakt mit anderen non-binären Menschen oder trans Menschen und ihren Geschichten. Queerness ist Teil der Kultur von jungen Leuten.

Arne Dedet/DPA
Es gibt Leute, etwa die Feministin Alice Schwarzer, die sagen, dass die Kinder indoktriniert werden, queer zu sein.
Das ist ein perfider Vorwurf. Das Gegenteil ist der Fall: Die Geschlechterbinarität ist eine Doktrin, die tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Frischgebackene Eltern werden gefragt: «Ist es ein Bub oder ist es ein Mädchen?» Vom ersten Tag unseres Lebens werden wir mit dieser geschlechtlichen Einschränkung indoktriniert. Dann geht das weiter in den Kleiderläden, wo es eine Abteilung für Buben und eine für Mädchen gibt. Und schliesslich mit all den anderen Klischees, die den Geschlechtern über die Jahrhunderte angehaftet wurden.
Wie werden Sie das einmal machen, wenn Sie Kinder haben?
Ich würde einen geschlechtsneutralen Namen wählen. Und kein Pronomen verwenden, bis das Kind selber bestimmen kann, welches Pronomen es für sich verwenden möchte.
Wenn ein Kind, sagt, sie oder er sei im falschen Körper geboren, kann das doch auch einfach eine jugendliche Laune sein. Was raten Sie Eltern?
Es gibt mittlerweile gute Studien, die besagen, dass nur drei Prozent aller Menschen, die in ihrer Jugend ihr Geschlecht hormonell oder chirurgisch transformiert haben, später damit nicht zufrieden sind und es wieder umkehren wollten. Eltern rate ich deshalb, diesen Wunsch unbedingt ernst zu nehmen. Sie sollten ihren Kindern gut zuhören, «gwunderig» sein und nachfragen. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit bekommen, sich mit Menschen auszutauschen, die gleich fühlen und den Schritt vielleicht schon gemacht haben.
Uns scheint, dass die LGBTQ+ Community vor allem die Unterschiede betont. Ginge es nicht viel mehr darum, die Gemeinsamkeiten stark zu machen: nämlich das Menschliche?
Damit man sieht, dass alle Menschen sehr ähnlich fühlen, schreibe ich Literatur. Das Ziel muss sein, dass geschlechtliche Identitäten keine Rolle mehr spielen. So weit sind wir aber noch lange nicht. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem System leben, in dem nicht alle die gleichen Rechte haben. Deshalb müssen Minderheiten gesetzlich geschützt werden. Ich erinnere an Bundesrat Ueli Maurer, der hofft, dass sein Nachfolger kein Es ist. Damit spricht er allen trans Menschen das Recht ab, ein politisches Subjekt zu sein.
Der Nachfolger von Ueli Maurer könnte Hans-Ueli Vogt sein, der erste homosexuelle Bundesrat, der sich öffentlich dazu bekennt. Ein Fortschritt?
Ich fände es vor allem sehr lustig, wenn die SVP einen schwulen Bundesrat hätte, hat sie doch die «Ehe für alle» abgelehnt. Dass Herr Vogt aber sagt, dass er sich nicht für LGBTQ+-Themen einsetzen würde, zeigt mir, dass seine Identität keinen Einfluss auf seine Politik hat. Das ist eine verpasste Chance – für ihn und für die Community.
Die SVP will den Genderstern an Schulen per Initiative verbieten. Wie wichtig sind inkludierende Schreibweisen für Sie?
Wir nehmen die Welt zwar nicht nur, aber immer auch über Sprache wahr. Es ist nicht das Thema, das mir persönlich unter den Nägeln brennt. Dass nun Kräfte dieses wortwörtlich winzige Zeichen verbieten wollen und dafür viel politischen Aufwand betreiben, zeigt, dass es um mehr geht, nämlich um die Macht, wer über die Geschlechter bestimmen kann.
Thomas Hürlimann findet den «Genderstern zum Kotzen». Ihnen persönlich ist er auch nicht wichtig?
Doch im Privaten schon. Ich verwende ihn auch, und mir ist es wichtig, dass er verwendet wird. Sprache war schon immer etwas Fluides. Wenn man Texte ansieht, die vor hundert Jahren geschrieben wurden, und liest, erkennt man rasch, dass das ein ganz anderes Deutsch ist. Der Versuch, Sprache starr zu halten, ergibt sich nicht aus ästhetischen Bedenken, sondern aus einer konservativen Politik.
Interessant ist ja, dass man erst in diese «Genderproblematik» gerät, wenn man über jemanden anderen spricht. Im direkten Dialog ist es so gut wie inexistent. In unserem Gespräch verwendeten sie kein einziges Mal den gesprochenen Genderstern, den Glottisschlag.
Das sagt viel über unsere Sprache aus. Wenn man miteinander spricht, ist die Sprache frei, wenn man über andere spricht, erzeugt man Festschreibungen. Wir sollten weniger über andere und mehr miteinander sprechen.