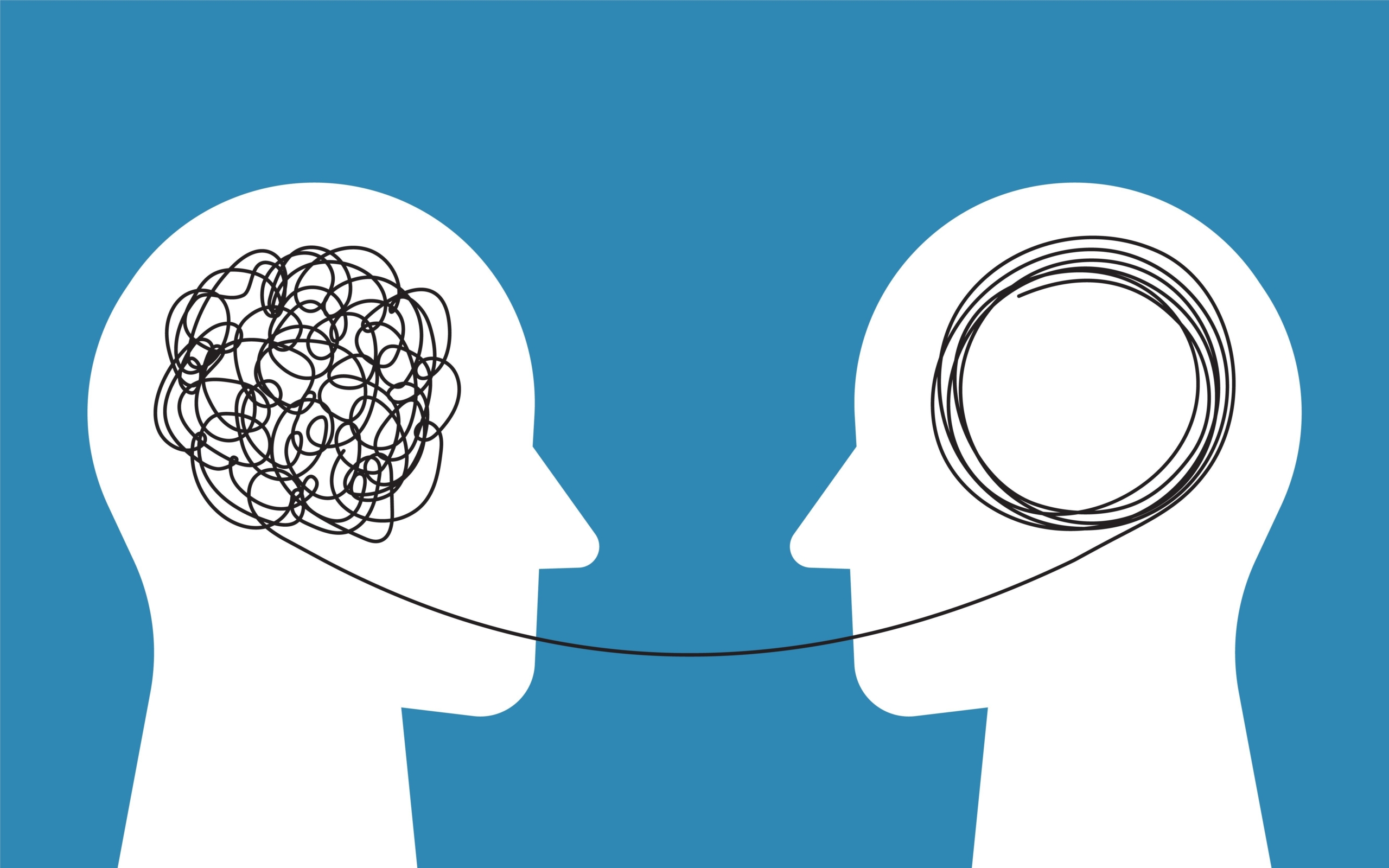Psychologe Allan Guggenbühl: «Ein halbes Jahr Freiheit nach der Pandemie ist noch nicht genug für die Jugendlichen»
Die schlechten Meldungen um die Jugend reissen nicht ab. Selbst jetzt, ein halbes Jahr nach Beendigung der Pandemie, sind die Wartelisten in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken lang.
Grund zur Sorge haben die Jugendlichen nach wie vor genug: In Europa ist Krieg ausgebrochen und auch die Klimakrise ist für niemanden bedrohlicher als für die junge Generation. Gleichzeitig sehen die Jugendlichen auf Social Media lauter schöne und erfolgreiche Menschen. Wenn man immer wieder mit Situationen konfrontiert ist, in denen man nichts ausrichten kann, setzt sich das Gefühl der Hilflosigkeit fest. Der Psyche schadet dies sehr.
Heute zeigen 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten, zehn Prozent sollten eigentlich behandelt werden, doch nur ein Prozent bekommt diese Hilfe tatsächlich. Das sagte kürzlich der Kinder- und Jugendpsychiater Oliver Bilke-Hentsch. Sein Kollege und langjähriger Psychologe Allan Guggenbühl bestätigt diese Einschätzung. Er betont aber, nicht immer müsse gleich ein Platz in der Psychiatrie gefunden werden und Möglichkeiten für ein erstes Gespräch könnten Eltern immer finden. In solchen Gesprächen ist er sehr direkt zu den Jugendlichen. Güggenbühl findet die verbreitete «Schaumsprache» schädlich, bei der nur gesagt wird, was das Gegenüber hören will.
Die Jugendlichen könnten wieder ungehemmt feiern, offiziell ist die Pandemie vorbei. Aber nach wie vor sind viele psychisch nicht gesund – überrascht Sie das?
Allan Guggenbühl: Nein, es überrascht mich nicht. Man muss die Jugendzeit zwei- oder dreifach rechnen: Ein Jugendjahr entspricht mindestens zwei Erwachsenenjahren, weil so viel passiert in dem Alter und es viele Aufgaben zur eigenen Persönlichkeit zu bewältigen gibt und der Frage: «Wer bin ich?» Das geschieht, in dem sich die Jugendlichen von den Eltern lösen. Sie müssen in einem halb-chaotischen Raum Erfahrungen machen. Durch Corona war das nicht mehr möglich. Nun muss die Kultur für diese Persönlichkeitsentwicklung erst wieder ins Laufen kommen.
Ein halbes Jahr Normalität reicht nicht?
Nein! Sich in Banden und Cliquen zu organisieren, wo solche Erlebnisse möglich sind, braucht Zeit. Corona hat Nachwirkungen. Ich merke in den Therapiegesprächen, dass die Jugendlichen am Suchen sind. Das wirft sie auf sich selber zurück, es geht ihnen teilweise erst jetzt schlechter, weil sie merken, sie haben nicht die Freundschaften, die sie gerne hätten. Und es gibt einen weiteren coronaunabhängigen Faktor: Wir lassen die Jugend etwas alleine.
Wie meinen Sie das?
Wir müssen die Jugendlichen in Schritten ins Erwachsenenleben begleiten. Dazu gehört in fast allen Kulturen das Aushandeln von Regeln und wichtigen Lebensinhalten mit dem Alten – etwa, welche Kleider, welche Frisuren man tragen darf und welchen Interessen man folgen soll.
Der Streit um unpassende Kleidung hat was Gutes?
Ja, heute mischen sich die Alten jedoch nicht mehr ein, die Jugend darf sich kleiden, wie sie will, was in Ordnung ist. Generell sind Gegenstimmen jedoch auch wichtig, sie helfen, sich zu finden. Unsere Ideologie hingegen ist, dass sich die Jugend selber finden muss.
Und das ist anstrengend.
Es gibt auch Vorteile. Die Jugend hat heute die Freiheit, den Beruf selber zu wählen. Der Nachteil ist: Sie sind ohne Hilfe fast unmenschlich gefordert. Es ist einfacher, sich selbst zu finden, seine Interessen zu entdecken, wenn jemand etwas von einem fordert, denn dann kann man dagegen sein. Wenn niemand von einem etwas will, ist es schwieriger. Viele wissen mit dreissig oder vierzig noch nicht, was sie wirklich wollen. Eine andere Problematik ist, dass wir die Jugend sehr lange ausbilden, jedoch zögern, ihnen Verantwortung zu übergeben.
Man muss auch mehr wissen heute.
Das stimmt. Aber für die Lebens- und Berufstüchtigkeit braucht man nicht nur Diplome. Diplome drohen, zu einer Selbstbestätigung der Geronten zu werden, also der Alten. Ein Mittel, die Macht bei sich zu behalten. Wir werden zu einer Gerontokratie! Was jemand kann, weiss man meistens erst, wenn der oder die Betreffende die volle Verantwortung für die entsprechende Tätigkeit trägt. Dazu braucht es die Übergabe von Verantwortung. Das ist ein Schwachpunkt unserer Gesellschaft, der sich auch auf die Psyche der Jugendlichen auswirkt.
Sie sagen, wir lassen die Jugendlichen alleine – sollen ihnen aber gleichzeitig mehr Verantwortung geben?
Das ist kein Widerspruch. Verantwortung übernehmen heisst, dass sie eine Arbeit selbstständig übernehmen können, Eigeninitiative entwickeln und auch scheitern dürfen. In der Berufslehre geschieht das zum Teil, da muss die Jugend nicht wie in akademischen Berufen jahrelang auf Tablets starren, leider besteht auch dort die Tendenz der Verschulung.
Die Lehrabbrüche sind nach wie vor hoch. Was hat das mit der Zeit nach der Pandemie zu tun?
Das hat weniger mit der Pandemie zu tun, viel mehr damit, dass wir Kinder mit Samthandschuhen anfassen. Wir wollen ihnen Frustrationen ersparen und tun so, als sei alles, was sie sagen oder leisten, super. Oft fehlen Momente, wo Kindern und Jugendlichen gesagt wird: Du musst dich anstrengen, denn du kannst auch scheitern.
Ist es nicht gerade dieses Leistungsdenken, unter dem die Jugend leidet?
Deshalb ist es eben Betrug, von Kindern nicht auch etwas zu fordern. In den Fortbildungen für Lehrmeister höre ich oft, dass die Lernenden denken, sie könnten in der Arbeit selbst bestimmen, was ihnen gefällt und was nicht. Und wenn sie müde sind oder kränkeln, dann sei es ihr Recht, dass der Betrieb dies berücksichtigt.
Kürzlich erwähnten Sie in einem Gespräch, es werde immer mehr «Schaumsprache» geredet. Gehört das auch dazu?
Mit Schaumsprache meine ich, dass man nicht nur sagen soll, was der andere hören will und dem Mainstream entspricht. Man muss auch Dinge sagen, die den anderen eventuell aufwühlen oder irritieren könnten.
Warum sollte man das tun?
Erst so kommt man in Kontakt miteinander, erst so werden wichtige Sachen angesprochen und man kommt weiter.
Aber man könnte jemanden auch vor den Kopf stossen und ihn als Freund oder Freundin verlieren.
Das ist das Risiko. Aber man verliert jemanden auch, wenn man nicht sagt, was ist. Wenn man nur auf Harmonie bedacht ist. Dabei gehört zu Beziehungen auch das Sich-nicht-Verstehen und die Frage: Wie meinst du das?
Sie begleiten Jugendliche seit über 40 Jahren. War das früher wirklich anders?
Ja, der Kontakt mit den Erwachsenen war konfrontativer. Ich erinnere mich, wie ich als Vierzehnjähriger an einem Kiosk die «Bravo» kaufen wollte. Da sagte die Kioskfrau: «Einem solchen Langhaardackel wie dir verkaufe ich keine ‹Bravo›.» Und die beiden Kunden neben mir empörten sich ebenfalls über meine Haare. Ein fantastisches Erlebnis!
Warum fantastisch?
Ich stiess auf eine Resonanz und wurde ernst genommen in meinem Auftritt. Auch die Lärmmusik der Beatles wurde nicht einfach so hingenommen. Heute findet man die neue Musik interessant, alle haben Verständnis.
Das lässt die Jugendlichen im leeren Raum?
Ja! Wenn ich ihre Musik nicht geniesse, dann gebe ich dies zu: Ich kann mit eurer Musik nichts anfangen. Das kommt nicht schlecht an.
Moment – fordern Sie gerade weniger Toleranz?
Ich rede von Authentizität. Ich werte niemanden ab, ich nehme die Jugendlichen ernst. Ich überlege mir, was ich wirklich finde und teile dies mit. Tolerant geben sich heute alle. Das ist verdächtig. Toleranz gehört zur Schaumsprache, weil alle diese Eigenschaft für sich beanspruchen.
Wann sollten Eltern handeln, wenn sie denken, das Kind verhält sich ungesund?
Es gibt viele Abstufungen von handeln. Manchmal genügt nur ein Gespräch, um ein Thema in einer Familie anzustossen oder die Eltern zu stärken. Man ist nicht entweder gesund oder krank und deshalb sind auch die Hilfestellungen abgestuft, von der Beratung bis zur stationären Therapie. Oft erkennen die Eltern aber gar nicht, wenn die Tochter eine Depression hat.
Das ist auch schwierig, oder?
Ja, Familienangehörige erkennen oft nicht, dass jemand von ihnen eine psychische Störung hat, bei der eine Beratung oder Therapie helfen würde. Denn man kennt sich gut und nimmt die Störung als eine Persönlichkeitseigenschaft wahr.
Aber was, wenn man gar nicht hin kann, weil die Wartelisten so lange sind?
Eine Beratung von einer Stunde sollte eigentlich immer möglich sein. Das Problem ist gerade, dass viele schon die Lösung im Kopf haben: Eine Einweisung in eine Klinik.
Das Bundesamt für Statistik meldete, dass in den Jahren 2020 und 2021 die Mädchen und jungen Frauen nicht nur generell wegen psychischer Probleme öfter stationär eingewiesen wurden, sondern auch 70 % der Einweisungen wegen Selbstverletzungen oder Suizidversuchen Mädchen und junge Frauen betrafen. Sind junge Männer resilienter?
Es ist so: Die psychiatrischen Kliniken sind voller Frauen, die Gefängnisse voller Männer. Die Geschlechter gehen mit Schwierigkeiten typischerweise anders um. Männer nehmen Probleme eher auf die leichte Schulter – dafür nehmen sie sie weniger ernst, was sie verschlimmern kann.
Die Strategie kann also gut oder schlecht sein.
Ja. Frauen wälzen die Probleme im Kopf länger, sinnieren und reflektieren, warum sie keine Freundschaften haben. Männer sagen eher: Ich bin halt so.
Warum?
Geschlechtertypische Unterschiede sind so vielschichtig, dass es sich nicht sagen lässt, ob sie angeboren oder anerzogen sind.
Wie können junge Männer sich besser reflektieren und wie lernen junge Frauen, Probleme auch mal beiseite zu schieben?
Über Kontakte mit Erwachsenen, die sie ernst nehmen. Jugendliche verhalten sich oft provokativ und sind ein Ärgernis. Dann ist es ganz wichtig, dranzubleiben und dem Konflikt nicht auszuweichen. Man muss aber auch auf ihre Ideen eingehen!
Bleiben Sie optimistisch bezüglich der psychischen Gesundheit der Jugendlichen?
Ich finde, man sollte pessimistisch denken, aber optimistisch handeln. Es gibt Veränderungsmöglichkeiten und Lösungen. Unsere offene und dynamische Gesellschaft hat viele Vorteile. Bei uns gibt es Debatten, man kann Fragen stellen, man darf sich über andere und den Staat ärgern. Das macht mich optimistisch. Die besten Gesellschaften sind die halb-chaotischen, sie ermöglichen neue Prozesse und Innovation.
Noch nie so viele Einweisungen von Jugendlichen in Psychiatrien
In den ersten beiden Jahren der Pandemie standen zuerst nicht die Jugendlichen im Fokus: Es waren die Ältesten, welche die Spitäler füllten. Doch wie eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) diese Woche zeigte, wurden gleichzeitig so viele Jugendliche wie noch nie wegen psychischer Probleme eingewiesen, fast 20’000 waren es 2021. Zum ersten Mal waren psychische Störungen die häufigste Ursache für Hospitalisierungen bei den 10- bis 24-Jährigen. Verletzungen waren die zweithäufigste Ursache.
Am stärksten betroffen waren Mädchen und junge Frauen: Bei ihnen stieg der Anteil der Einweisungen um 26 Prozent, bei den Buben und jungen Männern um sechs Prozent. Bei den jüngsten, den 10- bis 14-jährigen Mädchen gab es sogar einen Anstieg von «beispiellosen» 52 Prozent, wie das BFS schreibt. In den Jahren davor lag der Anstieg bei rund 3,4 Prozent.
Der Geschlechterunterschied gleicht sich ab 25 Jahren aus: Dann treten Männer wie Frauen ungefähr gleich häufig in Psychiatrien ein. Und in diesem Alter gab es in der Pandemie auch keine grossen Veränderungen.
Die Zunahme der psychischen Störungen betraf bei den Frauen im ersten Jahr der Pandemie vor allem Depressionen (+14%), bei den Männern Störungen durch psychotropische Substanzen (+8%). 2021 nahmen dann vor allem stressbedingte neurotische Störungen zu. Aber auch Persönlichkeitsstörungen wie Essprobleme nahmen bei jungen Frauen um 24 Prozent zu.
Auch Spitaleinweisungen wegen Selbstverletzungen und Suizidversuchen nahmen deutlich um 26 % zu. Wiederum betraf dies vor allem die jungen Frauen und Mädchen (70%). Und 10- bis 14-jährige Mädchen wurden elfmal häufiger deswegen ins Spital eingewiesen als gleichaltrige Buben. (kus)