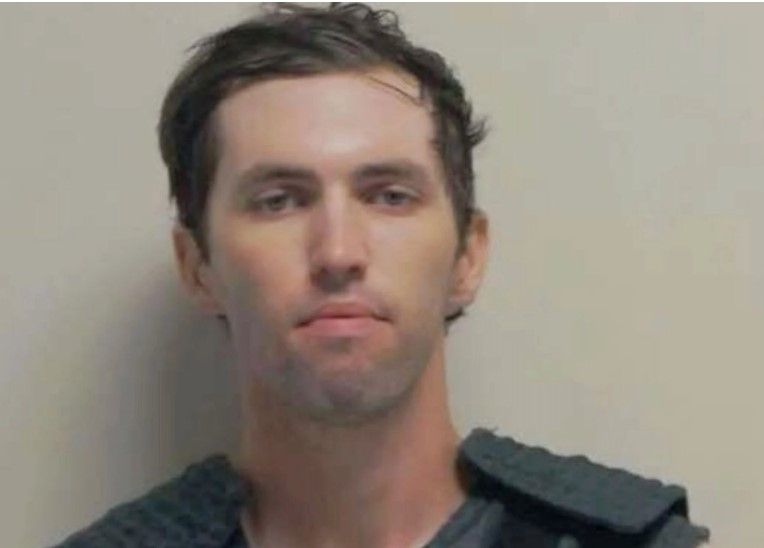Reform der Altersvorsorge droht Absturz: Wer rettet die BVG-Reform?
Es ist eine der wichtigsten Reformen dieser Legislatur. Sie entscheidet darüber, wie hoch die Renten der Zukunft ausfallen und wer diese wie finanzieren soll. Die von Bundesrat und Sozialpartnern angestossene Änderung der beruflichen Vorsorge verfolgt drei Ziele: Die Finanzierung trotz längerer Lebenserwartung und tieferen Anlagerenditen für die Zukunft sichern, Teilzeitbeschäftigten überhaupt eine Vorsorge ermöglichen und für alle Versicherten das Rentenniveau halten – oder gar verbessern.
Die Politik tut sich schwer mit dieser Aufgabe. Es steht viel auf dem Spiel, es geht um Existenzielles. Gleichzeitig sind die Änderungen sehr technisch und daher komplex. Das verdeutlicht sich an der wichtigsten Stellschraube, dem Mindestumwandlungssatz, der von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt werden soll. Er bestimmt, wie viel vom angesparten Altersguthaben monatlich als Rente ausbezahlt wird.
Für obligatorisch Versicherte bedeutet die Senkung eine Renteneinbusse von 12 Prozent. Weil es sehr unterschiedliche Wege gibt, dies aufzufangen, steckten die beiden Kommissionen für Soziale Sicherheit viel Zeit in dieses Projekt und verlangten Hilfe vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), das 35 verschiedene Berichte lieferte.
Was vor diesem Hintergrund schwer nachvollziehbar ist: Die Reform ist akut absturzgefährdet. Denn der Vorschlag der vorberatenden Kommission wird im Ständeratsplenum ziemlich sicher abschiffen. Die Vertreter der SVP sind dagegen, mehrheitlich auch die FDP sowie die Mitte-Partei. Sie finden, die Lösung sei viel zu grosszügig ausgefallen. Und was die Situation noch vertrackter macht: Es liegt zwei Wochen vor der entscheidenden Debatte keine befriedigende Alternative vor.
Wie konnte es soweit kommen?
Den ersten Impuls für mehr Grosszügigkeit lieferte der Nationalrat. Er verabschiedete mit klarer (bürgerlicher) Mehrheit Ende 2021 eine schlanke Vorlage. Er will Niedriglohn- und Teilzeitarbeitenden ermöglichen, sich eine eigene berufliche Vorsorge aufzubauen. Davon profitieren vor allem Junge und Frauen.
Bei der Übergangsgeneration zeigte sich der Rat strikt: Nur jene Personen, die obligatorisch versichert sind und deshalb mit einer Renteneinbusse rechnen müssen, erhalten eine Kompensation. Laut Schätzungen des BSV hätte jede dritte Person Anrecht auf einen Rentenzuschlag. Zum Vergleich: Der Bundesrat hatte in seinem Modell für alle Versicherten einen Zuschlag vorgesehen.
War der Nationalrat zu knausrig?
Bereits Anfang Jahr liessen bürgerliche Sozialpolitiker verlauten, es brauche Nachbesserungen, die Vorlage müsse sozial besser abgefedert werden, um auch in einer Volksabstimmung zu bestehen.
Der zweite Impuls für mehr Grosszügigkeit kommt aus der AHV-Debatte. Die Vorlage, die im September zur Abstimmung kommt, sieht eine schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 vor. Damit verknüpft ist das Versprechen, dass Frauen vor allem in der zweiten Säule finanziell besser abgesichert werden müssen.
Was nun die Kommission vor ein paar Wochen aus dem Hut zauberte, hilft nicht nur den Frauen, Tieflohn- und Teilzeitarbeitenden. Von Zuschlägen bis zu 200 Franken pro Monat sollen auch Personen profitieren, die zuletzt 8365 Franken pro Monat verdienten. Abgestufte Zuschläge von monatlich 50 bis 150 Franken sollen auch für höhere Löhne ausbezahlt werden. Erst wer mehr als 11950 Franken pro Monat verdient, kriegt nichts mehr. Profitieren würden laut BSV 88 Prozent der Versicherten.
SVP-Ständerat Alex Kuprecht arbeitete zwar auf einen Kompromiss hin, er sagt aber: «Ich habe nie verstanden, wieso wir die Kompensationen derart ausbauen sollen.» Parteikollege Hannes Germann spricht von einem «Wahnsinn». Wenn die Jungen dafür zahlen müssten, die Übergangsgeneration zu vergolden, mache die Reform keinen Sinn mehr. «Wem soll die Reform noch dienen?», fragt er rhetorisch. Bis weit in die Mitte hinein gilt das Vorhaben als überdimensioniert. Die Ausfinanzierung der Rentenzuschläge kostet gemäss BSV 25,2 Milliarden Franken. Der Vorschlag des Nationalrats 9,1 Milliarden.
FDP-Ständeräte richten Chaos an
Ursprung dieser schwierigen Lage ist gemäss Recherchen der «NZZ» ein «Missgeschick». FDP-Ständerat Josef Dittli hat den Vorschlag eingebracht – und sich verschätzt. Offenbar wollte er anfänglich noch grosszügiger Zuschläge verteilen, die Maximal-Version wurde in der Kommission abgewendet.
Gegenüber der «NZZ» liess Dittli durchblicken, er habe das finanzielle Ausmass nicht abschätzen können, sein Vorschlag sei «vermutlich» zu grosszügig ausgefallen. Als die FDP-Mitglieder Dittli, Damian Müller und Johanna Gapany in der Kommission plötzlich alleine auf der Seite der Rot-Grünen standen, merkten sie, was es geschlagen hat.
Für die Partei ist der Vorschlag Dittli indes kein gangbarer Weg. Weil aber als einzige Alternative das Modell des Nationalrats auf dem Tisch liegt, fehlt zwei Wochen vor der wichtigen Entscheidung ein Mittelweg, ein Kompromiss. Alle warten nun gebannt, wie die FDP aus diesem Chaos wieder herausfindet. Ratsmitglieder gehen davon aus, dass sie kurzfristig einen «Retter» küren wird, der über einen Einzelantrag einen Ausweg aus der misslichen Lage vorschlägt. Denn sowohl für FDP- wie auch Mitte-Strategen ist klar: Es braucht eine Alternative zur Variante Nationalrat, um die Vorlage überhaupt noch zu retten.