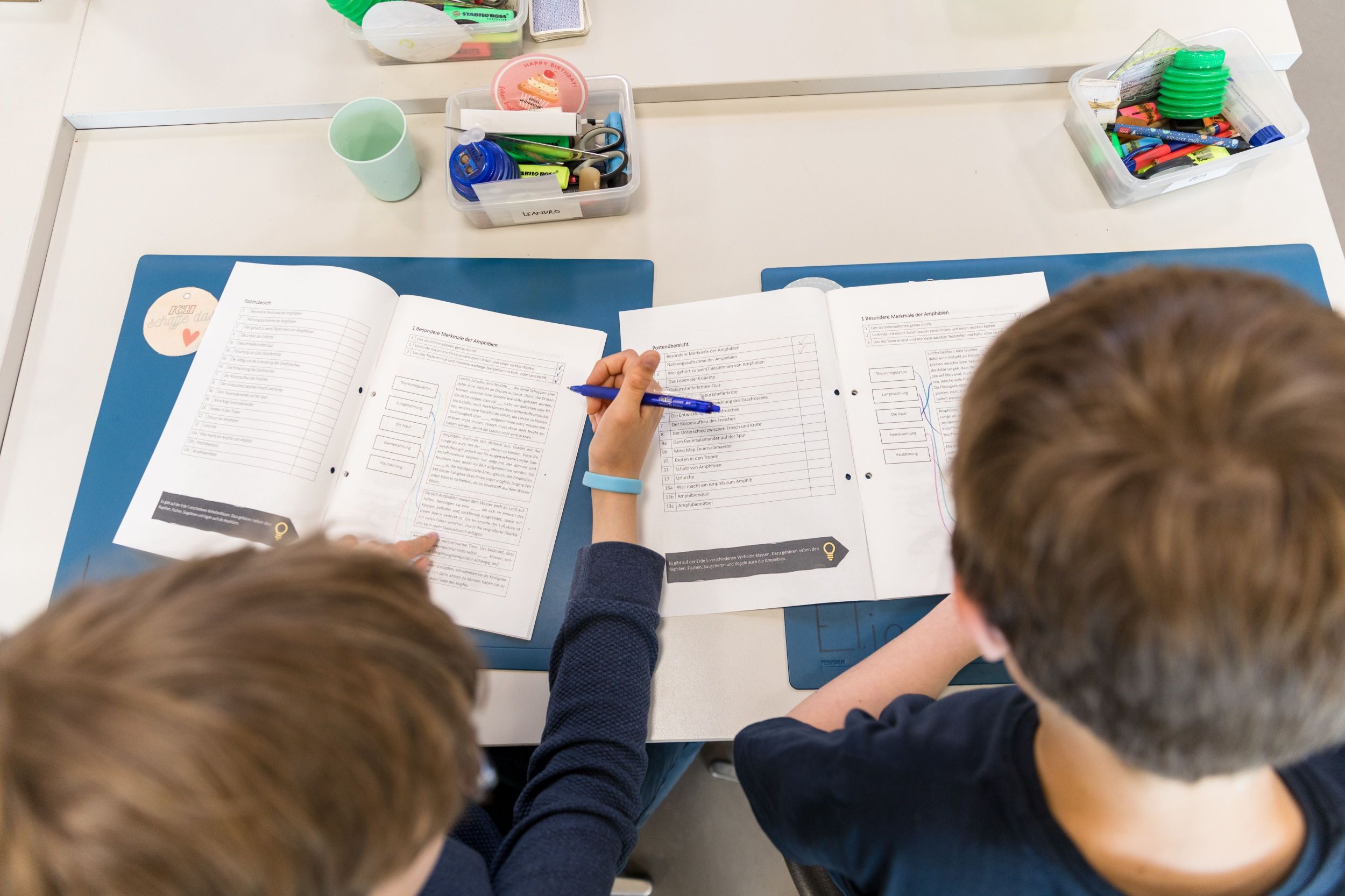Auf den Prämienschock folgen falsche Heilsversprechen zur Einheitskasse
Mehrere hundert Menschen sind am Montagabend in Bellinzona auf die Strasse gegangen: Sie protestierten gegen den Prämienanstieg, der im Tessin erneut überdurchschnittlich hoch ausfällt. Organisiert wurde die Demonstration – wie auch schon im Vorjahr – von den linken Parteien und Gewerkschaften. Sie nutzen den nachvollziehbaren Ärger im Südkanton, um ihr Wundermittel gegen den Prämienschock zu bewerben: die Einheitskasse.
Und sie finden Gehör, schweizweit: Mittlerweile glauben schon über 80 Prozent der hiesigen Bevölkerung, dass ein Systemwechsel hin zur staatlichen Einheitskasse grosse Prämieneinsparungen bringen würde. Doch dem ist nicht so. Mit dem Übergang von einem Vielkassen- zu einem Einheitskassenmodell wird letztlich einfach die Inkassostelle ausgewechselt. Das hat auf die Entwicklung der Gesundheitskosten keinen grossen Einfluss. So wie der Wechsel von Billag zu Serafe letztlich auch keine Auswirkungen auf die Qualität des Fernsehprogramms hatte.
Heute beläuft sich der administrative Aufwand bei den Kassen – inklusive dem alljährlichen Wechselspiel – kaum auf 5 Prozent der Gesamtkosten der obligatorischen Grundversicherung, und er würde auch bei einer mustergültig und superschlank geführten Staatskasse nicht auf 0 fallen. Mit der Einheitskasse könnten zwar Werbeausgaben eingespart werden – und vielleicht auch etwas Personal und IT-Kosten. Aber selbst eine Staatskasse gibt es nicht umsonst.
Für die Einheitskasse sprechen also keine wirtschaftlichen, sondern höchstens politische Gründe: Das Gesundheitswesen ist kein richtiger «Markt», wie von vielen gerne behauptet wird. Ärzte sind keine Unternehmer, die Kassen sind in der Grundversicherung alle gezwungen, mehr oder weniger das gleiche Produkt anzubieten, die Spitäler sind keine Firmen, sondern finanzieren überdimensionierte Träume mit Steuergeldern.
Das Gesundheitswesen ist vielmehr eine Kombination von bedingungslosem Grundeinkommen und Selbstbedienungsladen, bei dem alle – mehr oder weniger unkontrolliert – zugreifen können: Ärzte, Apotheken, Spitäler, Medikamentenhersteller, Kantone und natürlich auch die Patienten, die immer mehr konsumieren. Denn die Kasse bezahlt, egal bei welcher Grundversicherung man ist. Fehlanreize gibt es zuhauf, Lenkung nur wenig.
Solange die Gesundheitskosten Jahr für Jahr steigen, werden auch die Prämien mitsteigen – egal, wer die Rechnung verschickt. Der jährliche Prämienschub lässt sich nur eliminieren mit der Abschaffung von Fehlanreizen, die wünschenswerte Reformen hindern, etwa der Verlagerung von teuren stationären Eingriffen auf günstigere, qualitativ gleichwertige ambulante Leistungen ohne Spitalaufenthalt. Hier liesse sich «langfristig» rund eine Milliarde Franken pro Jahr einsparen, wie das Beratungsunternehmen PWC schon vor Jahren ausgerechnet hat.
Doch derzeit drückt die Verschiebung von stationär zu ambulant aufs Portemonnaie der Versicherten. Wenn heute eine Operation ambulant durchgeführt wird, dann müssen die Kassen und damit die Prämienzahler die Rechnung allein begleichen. Bleiben die Patienten über Nacht im Spital, übernimmt der Kanton mehr als die Hälfte der Kosten. Je besser der kostendämpfende Grundsatz «ambulant vor stationär» umgesetzt wird, desto mehr ziehen sich die Kantone aus der Finanzierung der Grundversicherung zurück, desto stärker steigen die Prämien.
Die Vorlage zur einheitlichen Finanzierung, über welche die Schweiz am 24. November abstimmt, dürfte diese Lastenverschiebung zuungunsten der Prämienzahler stoppen – und echte, kostensparende Reformen ermöglichen.
Das wollen nun die Gewerkschaften und ein Teil der linken Politiker und Politikerinnen mit ihrem Referendum gegen die einheitliche Finanzierung verhindern. Sie gehen dann lieber wieder auf die Strasse – mit ihrem Heilsversprechen, der Einheitskasse.