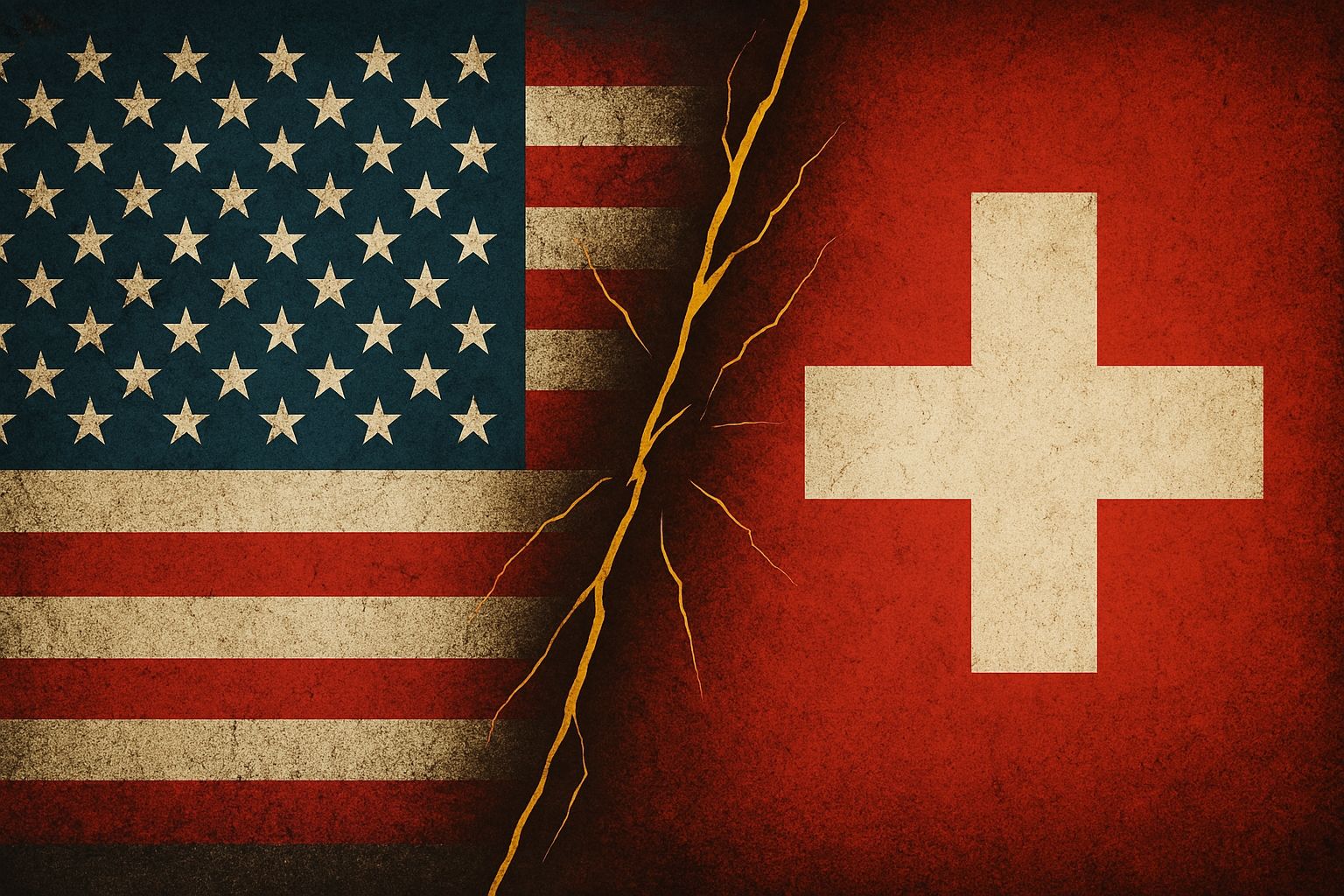Das Solardilemma: Die Schweiz tritt in eine heikle Phase der Energiewende
Manchmal fällt es nicht leicht, die verschiedenen Nachrichten zur Schweizer Energiewende zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Da war die Schlagzeile, dass Schweizer Hauseigentümer 2024 für einen neuen Rekord beim Bau privater Solaranlagen gesorgt haben. Mehr als zehn Prozent des Schweizer Stromverbrauchs wird nun von der Sonne gedeckt.
Gelingt jetzt die Energiewende?
Nur Tage später macht die Neuigkeit die Runde, dass ein vielversprechendes Alpinsolarprojekt auf der Alp Morgeten trotz kantonaler Bewilligung von den Gerichten ausgebremst wird. Wieder einmal. Trotz vereinzelter Erfolgsmeldungen: Der Solarexpress ist längst zum Bummler geworden. Dabei hatte das Parlament unter dem Eindruck einer drohenden Mangellage ein Eilgesetz durchgepeitscht, um den Ausbau der Solarkraft voranzutreiben. Dass das angestrebte Ziel von plus zwei Terawattstunden Solarstrom bis Ende dieses Jahres zugebaut wird, glaubt mittlerweile niemand mehr.
Ist die Energiewende gescheitert?
Widersprüche allenthalben. Und doch folgen die aktuellen Geschehnisse einer inneren Logik. Eindrücklich beweist die Schweiz, dass die eigene Betroffenheit über Zuspruch für oder Einsprache gegen ein Projekt entscheidet. Wer auf tiefere Stromkosten hofft und die Installation noch von den Steuern abziehen kann, montiert eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach – ganz unabhängig davon, ob er im Sommer zu Negativpreisen auf dem Strommarkt beiträgt.
Wer hingegen keinen persönlichen Nutzen zieht aus einer Freiflächenanlage, die der Schweiz dringend benötigten Winterstrom liefert, stimmt in einer Gemeindeversammlung mit Nein – oder geht im Extremfall gerichtlich dagegen vor.
Fatalismus ist fehl am Platz
Fatalismus ist trotzdem nicht angezeigt. Man kann sich die Schweizer Energiewende als schlecht geölte Maschine vorstellen: Mal macht sie einen Satz nach vorne, mal stockt und stottert sie wieder, doch aufhalten lässt sie sich spätestens seit dem Ja der Schweizer Stimmbevölkerung zum Stromgesetz nicht mehr. Am Solarexpress alleine hängt die Versorgungssicherheit allemal nicht.
Und doch befindet sich die Entwicklung an einem sensiblen Punkt: Es ist der Übertritt in eine Phase, in der nicht mehr nur das Tempo des Zubaus entscheidend sein wird, sondern auch, wie die Schweiz mit ihrer verfügbaren Energie haushaltet.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben nicht ohne Grund Solaranlagen für 400’000 Haushalte aufs Eigenheim geschraubt. Am liebsten noch in Kombination mit einer Batterie. Sie taten dies in einer Sehnsucht nach Unabhängigkeit und Sicherheit.
Relikte aus der Vergangenheit
Die Energieversorgungsunternehmen tun es den Privathaushalten gleich. Im vergangenen Jahr gerieten plötzlich Speicherlösungen in den Fokus: riesige Batterien, Wasserstofftanks und sogar Wärmespeicher, um überschüssige Energie vom Sommer in den Winter zu transferieren. Die Rechnung ist schnell gemacht: Mit günstigen oder sogar negativen Energiepreisen lassen sich im Sommer die Depots füllen, die dann im Winter bereitstehen.
Das ist aber nur der Anfang. Niedertarife in der Nacht sind ein Relikt aus der Vergangenheit. Künftig werden intelligente Systeme dafür sorgen müssen, dass sich die Autobatterie möglichst dann lädt, wenn die Sonne aufs Dach scheint und der Strom deshalb günstig ist. Mit den technischen Entwicklungen wird nicht nur die Stromproduktion flexibler, sondern auch der Verbrauch. Gut möglich, dass dieser Sommer den Leuten erstmals deutlich ins Bewusstsein rufen wird, wie viel Strom zu gewissen Stunden verfügbar ist – und dann selbst ein verschwenderischer Umgang damit kein Problem ist.
Einfach wird die Umstellung auf diese neue Phase nicht. Neue Widersprüche, Fort- und Rückschritte sind programmiert. Aber wer sich auf neue Produktions- und sogar Lebensrhythmen einstellt, wird zu den Gewinnern der Wende. Misstrauisch werden sollte man hingegen dann, wenn jemand eine einfache Lösung für die Energieprobleme der Schweiz verspricht. Dafür ist die Gesamtlage schlicht zu unübersichtlich.